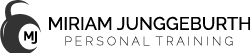Tag 18 …ein grauer vertrackter Tag: Keine Wolke, keine Welle, kein Wind – „Kalmen“ abgehakt!
Nachdem die Spanisch-Lektionen wiederholt sind, nimmt Oswald Spengler mich wieder in Beschlag – ich verquere mich in seiner überheblichen Sprache, die wiederholt von „faustischer Kraft“ geprägt ist: „Wo Zweifel am Glauben wächst Wissen, wo Zweifel am Wissen wächst Glaube“. Der nachmittägliche Rundgang schenkt mir eine Mussestunde im Bugkorb. 1800 – wir dümpeln vor Buenaventura, dem Hafen Kolumbiens; der Pilot ist überfällig, weit und breit nicht zu sehen. Die See ist flach wie eine Flunder. Abendwolken bauen sich auf, wollen Regen ablassen – Regenwälder links und rechts der Fjordeinfahrt; der Himmel spielt mit den Farben des Regenbogen.
Kaum hat sich der lange Tag in die Nacht begeben, kaum ist der Schlafanzug übergezogen, kündet die Stimme des Käpt‘ns von der Brücke Überraschungen an: Arzt an Bord – Coronavirus hat uns eingeholt. Die weltweite Epidemie ist auf „Jean Gabriel“ angekommen: Alle Mann zum Test auf Deck „U“. Aufregung macht sich breit – wenn denn wirklich jemand Fieber haben sollte, lägen wir hier 14 Tage in Quarantäne, kein schlechter Gedanke.
Treu und brav stellen sich alle der Crew-Liste nach auf, dann schickt der Chief-Officer die 30 Mann ungefragt in die Kabine der Wachmannschaft, aus der Enge erlöst uns Minuten später der Kapitän und bittet uns aussenbords – und dann erscheinen die beiden androgyn eingekleideten kolumbianischen Mestizen mit Maske im Operationsdress, legen mit der Pistole an und messen die Temperatur an der Stirn. Der Kapitän ist der Erste – er strahlt, er kann wieder zurück: unter 37 °. Der Hierarchie nach baut sich die Schlange ab. Kim, unser Wachoffizier, erwischt es – er wird ausgesondert und darf vorerst nicht auf die Kabine zurück. Die andern passieren anstandslos: „trenta sei, siete“, kündet die etwas mollige Ärztin bei mir – geschafft. Mein Blutdruck wäre sicher anders ausgefallen. Entspannung aber ist erst angesagt, als ein Fieberthermometer herbeigeschafft ist, das nun auch Kim entlastet: Fieberfrei !
Entspannt begeben wir uns zurück auf die Kabinen, ehe die nächste Botschaft die Runde macht: CMA CGM nimmt keine Passagiere mehr auf, alle Passagen auf der Rücktour abgesagt – einzig Harald kann bleiben: Einsamkeit sind Norweger ja gewohnt.
Tag 19 …. wieder einmal Sonntag. „Buenas Dias!“Es ist schon der dritte Sonntag an Bord, eben war doch noch Barbecue, aber das war schon am letzten Wochenende. Noch ein Sonntag erwartet uns… aber an Bord ist für uns alle Tage Sonntag – heute kleide ich mich neu ein, um mir sonntäglich zu gefallen: „Ay, Ay, Sir – einkleiden“! Draussen rackern die Kräne – es regnet.
0900 – Leinen los, der Schlepper schiebt uns ein wenig, dann schon erreichen wir die enge Wasserstrasse, die uns nach etwa 3 nm in die See entlässt – noch drei Grad bis zum Äquator, dann sind wir auf Höhe von Ecuador, das sich den Namen entliehen hat.
Der Tag rauscht ab, die Schiffsgeschwindigkeit ist mit 11 kn nicht sehr hoch, die See liegt flach, ab und an eine Insel „No Go Area“. Oswald Spengler gibt den „Untergang des Abendlands“ nach 700 Seiten bekannt: „Wo Geist sich mit Geld mittelt, ist Dekadenz angesagt“,seine Botschaft. Lektion 7 im Spanischkurs fordert mich. Peter Frankopan macht wieder das „Licht des Ostens“ an – sein Buch rechtfertigt nachträglich mein Interesse an Zentralasien und Fernost: Wo sonst finde ich einen Text über Balasagun, dem Ort der Karachaniden in Kirgistan, an dem nur noch ein halber Turm zu sehen ist.
Tag 20 …We did it ! 1503 – wir überqueren den Äquator, d.h. eigentlich unterqueren wir ihn, denn das weltumspannende rote Seile, das Neptun den Seeleuten für eine erfolgreiche Querung hat anlegen lassen, wird hier – auf 80 ° westlicher Länge – von zwei Mermaids im Dienste von Njai Loro Kidul über 50 m aus dem Wasser gehoben, damit „Jean Gabriel“ ungefährdet passieren kann; nur wenige Seefahrer haben einen Blick erhaschen können von diesem seligen Moment, den wir leider nicht in Bildern festhalten können, weil unsere Kameras dummer Weise auf den GPS – Schirm gerichtet waren, während die Töchter Neptuns ihren Tanz vollführten, aber die alten Seeleute sagen, sie hätten auch Neptun schon in diesen Gewässern gesehen… aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Ansonsten hat der Tag auch noch andere Botschaften, die aufhorchen lassen – unser Ausflug von Callao nach Lima ist gestrichen. Die peruanischen Behörden lassen niemanden von Bord. Wenn das auch in Chile so läuft, sind wir gedanklich darauf vorbereitet, den Heimweg nach Hamburg wieder mit unserer „Jean Gabriel“ anzutreten – versorgt sind wir ja und Spass haben wir auch. Lektüre ist vorhanden und die Tage auf See – einer wie der andere. Es ist doch egal, wo wir auf den Tod warten.
Wolfgang hat heute den Bogen ein wenig überspannt – und als Bruder Leichtfuss die Treppe mit den schmalen Stufen zu leicht genommen. Ein paar Kratzer, aber schlimmer noch – das Smartfon hat den Geist aufgegeben: und was sind wir heute ohne Smartfon ? Unbrauchbar, nicht verwertbar oder verfügbar ! Adresse und Telefonnummer seiner Freunde in Chile sind darauf gespeichert – wie froh bin ich, noch ein Stück Papier in Händen zu halten.
Die Ungewissheit nagt an unseren Nerven. Der Kapitän hat auch noch keine Informationen für Chile, er erfährt morgen mehr. Aber warum soll in Chile die Einreise erlaubt, in Peru jedoch verweigert werden – Peru ist doch viel kleiner und hat weit weniger internationalen Kontakt: „Das Herz muss bei jedem Lebensrufe, bereit zu Abschied sein und Neubeginn. Wohl an denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“ – Hermann Hesse stärkt mein Gemüt.
Tag 21 … verschlafen. 0710 wache ich auf. Nur weil ich meinen Taschenwecker an Wolfgang ausgeliehen habe, nein, im Ernst: ich schlafe ja auch sonst ohne Wecker – aber heute habe ich in der zweiten Phase viel geträumt. Und schon fragt Wolfgang um 0730 nach, ob alles in Ordnung ist; so wächst eine Gefahrengemeinschaft heran, die wohl auch noch ein paar Tage länger zusammen bleibt.
1100 – Posorja. Ziel erreicht, die Kräne diesmal in mausgrau, der Hafen wohl noch keine zwei Jahre alt, die Zahl der Container überschaubar – ein kleiner Fischerort. Die Boote drehen sich im Schwell. Ecuador – der Name löst eigentlich nur Darwin und Galapagos aus, aber das reicht für die Geschichte.
Ich versinke in Peter Frankopan’s Lichtern des Ostens – welche Zusammenhänge er erschliesst, die mir immer verschlossen blieben: Letzter Schrei – auch die Beulenpest im 16. Jahrhundert kam über die Handelswege aus China, irgendeine Ratte hatte Läuse gebunkert, die durch den damaligen Temperaturanstieg wohl Bakterien erweckten, die alsdann Millionen Menschen in der zivilisierten Welt dahin rafften. Kommt der Coronavirus nicht auch aus China – und erleiden wir im Augenblick nicht auch eine menschengemachte Klimakatastrofe, in deren Verfolg sich Methan aus dem Permafrost und CO2 aus dem Meereswasser löst – und damit Viren und Bakterien erweckt, die wie Schläfer nur auf diesen Moment gewartet haben, um zum Leben erweckt zu werden? 96 % ist dunkle unbekannte Materie, nur 4 % – so die Annahme – materielle Welt, von der uns – wiederum geschätzt – bislang nur 2 % bekannt geworden sind: welche Welten schlummern noch in diesem Universum ?
1800 – jetzt ist es amtlich: Chile verweigert uns die Einreise – Kommando zurück: Die ganze Strecke noch mal rückwärts. That‘s life! Ian stellt uns freundlicher Weise sein Smartfon zur Verfügung: „Immigration to Chile denied; we sail back with the ship to Hamburg. Arrival supposedly last week in April“ – lautet die sms-Botschaft an Gisela und Karsten; eine kleine Gewissheit mit soviel Wirkung. Heute Nacht kann ich gut schlafen.
Tag 22 …der mit Delfinen lacht. Ein strahlender Morgen – und die Sonne steht im Norden!
Nach der 8. Lektion des Spanischkurs, der mir die rechte Uhrzeit nahebringt, und der Lesestunde im „Lichte des Ostens“ brauche ich frische Luft – der tägliche Rundgang auf Deck „U“ ist angesagt. Die Kadetten arbeiten sich an den angefressenen Flecken ab, säubern sie und bestreichen sie in dem Grau, dessen Farbe sich über die Schuhe weiterträgt bis zu meinem Standardsitz – diesmal auf der Sonnenseite in Luv, wo mich ein kräftiger Südwind kühlt. Wir fahren wieder 20 kn, der Pazifik nimmt das Blau des Himmels nicht so satt an wie der Atlantik, obwohl „El Nino“ eigentlich Tiefenwasser hoch spült, aber dazu sind wir mit 30 nm noch zu nah unter Land, das gelegentlich mit einem Hügel im Dunst erscheint und den westlichsten Landpunkt Südamerikas anzeigt.
Ich spüre die physische Anstrengung auf dem schmal in gelb eingezeichneten Weg, mich aufs Vordeck vorzuarbeiten, dort auf die obere Ebene zu steigen, wo die Taue, Anker und Winschen aufgestellt sind, um den Koloss zu binden und zu bändigen. Und eine letzte 5-stufige Leiter – dann bin ich oben im Bugkorb und spüre den Auf- und Niedergang des Schiffes im Stampfrhythmus. Wie auf meinen inneren Ruf schauen nun die ersten Delfine vorbei, springen vor dem Schwell behend aus dem Wasser, legen sich auf die Seite, um mich oben im Korb zu sehen und mit mir ihr Spiel zu treiben. Erst sind es drei oder vier, dann plötzlich springen andere mit ein, dann tauchen sie zu viert auf einmal aus dem Wasser, als ob sie mich im Dutzend erfreuen wollen – und das Ganze mit mehr als 40 km/h vor der Bugnase.
Mein Versuch, sie mit Video einzufangen versagt, aber ein, zwei Fotos bleiben, die zu Mittag von der besonderen Begegnung berichten. Drei Wochen haben wir jetzt schon den Alltag an Bord erlebt, fünf Wochen stehen noch aus, um an den Landungsbrücken in Hamburg die glückliche Rückkehr zu feiern.
Tag 23 …ich bin sauer: eigentlich eine unhöfliche, wenn nicht flegelhafte Bande.
Ich stehe um 0600 Uhr auf, um den Sonnenaufgang zu geniessen, schaue mich auf dem Seitendeck um, wo der Wind mich mit 6 – 7 Stärken bürstet, also entscheide ich mich für Sonnenaufgang auf der Brücke. Glenn hat Wache, alles noch dunkel, gedimmt auch das Radar. Ein Lookout ist mit ihm; ein weiterer Oiler reinigt den Boden, wischt die Pulte – ein freundliches „Good morning“ mit einem nachgeschobenen „Everything allright ?“ macht die Runde, aber meine Filippinos verstecken sich unter ihren Kapuzenpullovern, kein Wort, nicht einmal ein Rülpser. Das mag ja mit dem Nachtdienst zu tun haben, aber Höflichkeit definiert sich anders, Sir; immerhin ist Glenn „designated officer“ d.h. für die Passagiere der Ansprechpartner an Bord für ihre Wünsche… und „Guten Morgen“ ist immerhin ein Wunsch. Was soll‘s – Höflichkeit ist eine Tugend, die sich in diesem rauen Job nicht jeder leisten kann.
0645 – mein Blick gleitet seitwärts, der Kapitän hat sich ohne ein Wort ‘reingeschlichen, kein Blick, keine Freundlichkeit; sein Chief-Officer betritt lautstark die Bühne, jegliches andere Gespräch erstarrt, wenn die beiden sich serbo-kroatisch unterhalten. Kein Blick, kein Gruss auch von diesem Koloss. Bordsprache, habe ich gelesen, sei „englisch“ – die einen tratschen in tagalo, die andern donnern krachend ihre kroatischen Lacher unters Volk, irgendwie bin ich hier ein nullum, ein nichts, zumindest nimmt uns niemand wahr, uns Störenfriede. Nein, das ist nicht die Mannschaft, die ich suche. Da erinnere ich mich gerne an Dragon Radic, meinen Kapitän auf der „Puget“. Da lob‘ ich mir unsere kleine Gesellschaft, die sich sichtlich müht, sich allenthalben in englisch Gesellschaft zu leisten. Das einzige englische Wort dieser Offiziere ist „Good appetite“, ohne uns anzuschauen, wenn sie zur Essenszeit in die Messe kommen, oder – nach dem Futtern – die Messe wieder mit einem apathischen „Good appetite“ verlassen, ohne uns anzuschauen: Nun ja, das zeigt zumindest, dass sie mal im Trog was Englisches gefunden haben. Ich spüre: Meine Freundlichkeit hat Grenzen – für 150,00 € am Tag wüsste ich mir an sich besser zu helfen, basta!
Die Blase drückt – das musste mal raus! Heute Abend neues Land: Peru – Callao, nicht weit von Lima, steht für 2000 lt auf der ETA, aber unser Landgang steht in den Sternen. Wir leben wie vor einem Vorhang, hinter dem sich die Welt abspielt – wir sehen nichts, wir hören nichts: einzig Stille, allein der Wind singt ein Lied, wenn er sich am Fensterrahmen bricht. Die Zeit bricht ein, das Gefühl für Wochentage geht verloren, Liederlichkeit greift um sich – immer den bequemsten Gang, die leichteste Tour. Innehalten – bei sich sein, deutscher Idealismus gegen neoliberale Verwertungsgesellschaft. Ahoi!
Peter Frankopan stimmt Christopher Clarke zu, die wechselseitige Angst, der Verlust der gewonnenen wirtschaftlichen Macht und der Territorien – in Deutschland droht ein neuer Machtfaktor, der die Balance bricht, nachdem sich der Preussenkönig nach dem gewonnenen preussisch-französischen Krieg 1870/71 im Schloss von Versailles zum „deutschen Kaiser“ krönen lässt, was Rachegelüste in Frankreich auslöst. Krieg war 1914 im Denken die einzige Lösung, um die Gewichte wieder herzustellen; es bedurfte nur des Zündfunken von Sarajevo, um die Interessen zu bewaffnen – und Deutschland im Versailler Vertrag die Alleinschuld unterzeichnen zu lassen: Grundlage für den Despoten des Dritten Reichs, das „Schanddiktat“ von Versailles zum Anlass zu nehmen, in Revanche einen neuen Krieg anzuzetteln, um zu realisieren, was alle schon 1914 befürchtet hatten – Deutschland als europäischen und globalen Machtfaktor zu etablieren “ … und morgen die ganze Welt“..
Was hilft es, wenn sich nun Politik und Medien darauf verschwören, die AfD-Bande als Nazis zu brandmarken, wenn sie nicht gleichzeitig die Gründe beseitigen, die den „Despoten“ den Grund für ihre Erfolge liefern: die Agenda 2010 und in ihrem Gefolge die finanzielle, soziale und politische Ungleichheit, die in der neoliberalen Gefolgschaft den Menschen nur noch als Verwertungsobjekt wahrnehmen, ist das Pendant des „Versailler Vertrages“ einhundert Jahre später – und wer hat uns wie immer verraten: damals wie heute – Sozialdemokraten!
Ein Tropenhimmel schwärmt in prächtigen Farben – ein wunderschönes Setting für den nahen Hafen. 2000 – wir warten auf den Lotsen. Mit „Dead Slow“ nähert sich „Jean Gabriel“ den Lichtern der Stadt, die wir nur ahnen, aber nicht sehen dürfen. Ohne diese Unterbrechungen der Seereise gerinnt der wochenlange Ausflug nach Südamerika zu einem langweiligen – „same procedure as every day“ – WindWellenWasser- Erlebnis. Irgendwie bin ich dann doch in ein Loch gefallen – die Spannung der Reise, die doch eine neue Dramaturgie nach Ankunft in San Antonio versprach, ist dahin. Alles verflacht – die Lust, die Laune, die Laute. Und wenn dann noch der verwässerte Blumenkohl sich mit dem ledernen Rindfleisch paart, ist der Tag gelaufen. 2300 Lotse ist endlich an Bord. Buenas noches!
Tag 24 … Callao, die verbotene Stadt.
0100 – endlich fest. 3 Stunden Gewackele ohne Fahrt im Warten auf den Lotsen. Und am Morgen ein lausiges Bild, trübe Aussicht auf eine ansonsten flirrende Stadt, die sich schon herbstlich eingekleidet hat. Plötzlich ist alles schwer, irgendwie „seltsam, im Nebel zu wandern…“. Wir stochern im Nebel. Gisela trauert um die verlorenen Tage in Neuseeland; sie kündigt in ihrer sms an, schon nächste Woche zurück zu fliegen. Das Risiko, hängen zu bleiben, ist ihr zu gross. What a life. Ein historischer Moment – vielleicht auch die letzte Gelegenheit, auf Frachtern mitzufahren. Und um das Mass voll zu machen, schickt Arne Gudde uns auch schon mal prophylaktisch die Kostennote für die Rückreise.: „Arne, wir haben keinen Vertrag für den Rücktransport; der geschieht ohne, nein, gegen unseren Willen“. CMA CGM versteckt sich hinter dem Agenten, als sei das alles zum Wohl der Passagiere; aber wir sind ab San Antonio keine zahlenden, sondern deportierte Passagiere. Mein Hirn blättert unter „812“ – ungerechtfertigte Bereicherung, aufgedrängte Bereicherung und der Aufrechnung mit all der Liebesmüh, 11 Tage auf das Schiff zu warten. Ob Rotterdam oder Hamburg – das werde ich kurzfristig entscheiden. Mir ist irgendwie kalt.
Wenigstens die Sonne wagt sich hervor und gibt Callao einen eigenwilligen Reiz mit der weit ins Meer hineinreichenden Landzunge und den unüberschaubaren Mengen an Containern, mit denen sich Schiffe und Land füllen. 5 Kräne arbeiten an unserem Schiff und räumen aus. Die Kirche ist hier – anders als in Panama City – immer noch das höchste Gebäude.
Wir sind zur Untätigkeit verdammt, nicht einmal ein Spaziergang auf Deck „U“ ist angesichts der Ladearbeiten angesagt. So gewinnen plötzlich Sorgen Raum, die vorher nie eine Rolle gespielt haben – Kontakte, das war doch alles bis Valparaiso berechnet – und nun nochmals 4 Wochen mehr, es ist wie im Kloster unter Trappisten, aber die dürfen sich nicht einmal untereinander austauschen, es sei denn im Gebet. Wolfgang hat sein Passwort vergessen – mit dem verschossenen Handy auch die ganze Liste der Buchungsnummern. Und schon vergeht ihm das Lachen, weil er sein Hotel in Valparaiso und seinen Flug nicht stornieren kann. Ich habe Glenn gebeten, uns entweder einen Code fürs lokale Internet zu besorgen oder aber eine Mail-adresse einzurichten – mal sehen, ob er wenigstens das schafft; ich musste ihn daran erinnern, dass er unser Ansprechpartner ist, sonst berichte ich dem Kapitän. Es brodelt.
1830 Kein Zeichen von Glenn, der sauer ist, weil ich ihn in der Mittagsruhe gestört habe – „one minute, Captain“. Ich halte ihn am Tisch an und schildere, dass wir in dieser neuen Situation unseren Familien Bescheid geben – ob er uns hilft, uns eine Mail-Adresse zu verschaffen. Und siehe da – ab nun läuft alles schnell. Rick erscheint am Tisch und will mir ein paar megabites fürs Internet verkaufen, das ist mir zu teuer, ich möchte nur eine Mail senden. Das System gibt es nicht mehr auf dem Schiff – aha ? Wie kommen denn alle diese Ausdrucke an, bevor der Printer sie ausspuckt ? Nein, gibt es nicht. Kaum sind wir in blasser Stimmung aufgestanden, tönt das Telefon – der officer on duty meldet sich, ein PC stünde bereit für Mails. Erschreckend und erstaunlich zugleich – und Rick spielt den 2nd officer an Bord. Kim ist der „officer on duty“ auf Deck „U“, hat alles arrangiert, und ich muss nur noch eintippen, mit Kopie an den Käpt‘n. Danke!
Tag 25 …Wochenend und Sonnenschein, und dann…
Der Schalmeienklang der Nacht, als mit Alarmsirenen die letzten Zwischendecks eingezogen werden, ist verklungen, die leisen Geräusche der See und das leichte Rollen des Schiffes geben uns Gewissheit – es geht weiter: Wir segeln Kurs Südsüdost. Chile ist nur noch drei Tage und zwei Zeitzonen entfernt. „Buenas dias, que tal ?“ mische ich den morgenmüden Tisch auf: „Vamos para Chile, amigos“. Wie verliefe eigentlich das Spiel, wenn jeder am Tisch nur seine Sprache spräche und wir uns nur über Gesten und Gurrlaute unterhalten müssten – wir wären wieder Kinder, die eine gemeinsame Sprache erfinden, um sich zu finden. „Plopp, Haluwa, Lil“ – wie war das noch, Freunde ? Erinnerung verblasst.
„Isch over“, möchte man die Fratze des Neoliberalismus in unserem Lande zitieren, wenn man die Schlussfolgerung von Frankopan und seinem tollen Abriss der vernachlässigten Geschichte des Ostens teilt: Geld und Gier hat ausgedient, die desaströse Politik des Westens – sprich: der Vereinigten Staaten und ihre liebedienerischen Vasallenstaaten in der NATO – nach dem II. Weltkrieg, die mit imperialer Gewalt unter Bruch des Rechts und – schlimmer noch – der Loyalität allein darauf ausgerichtet war, andere Länder und Kulturen, die dem „american way of life“ im Wege stehen, mit Regimechange zu bedrohen oder zu bestrafen (Korea, Iran, Vietnam, Kuba, Chile, Nicaragua, Grenada, Panama, Afghanistan, Irak, Angola, Somalia, Jemen, Libyen, Syrien, Venezuela u.a.m.), zum anderen die für die Überflussgesellschaft notwendigen Energien Öl und Gas herbei zu schaffen („no blood for oil“). Kissinger, Brzsinski, Reagan (Irangate), Bolton, Bush, Rumsfeld, Cheney und Wolfowitz geben dieser Politik über die Zeiten das schärfste Gesicht, Guantanamo und Abu Greib das prägnanteste Bild.
Churchill hatte dazu in der Konferenz von Jalta mit dem Eisernen Vorhang die Interessensphären für die Zeit des Kalten Krieges von 1945 bis 1990 abgegrenzt und damit die Grundlage geschaffen, Amerika mit seiner Hybris, die Welt vor dem Kommunismus zu bewahren, unter Bruch des Vertrauens seine Militärmacht in völkerrechtswidrigen imperialen Kriegen „im Interesse nationaler Sicherheit“ in jenen Gebieten tödlich, gewaltvoll und schmählich eingesetzt, in denen Frankreich (Indochina/Syrien) und England (Afghanistan, Irak, Iran, Palästina) ihre chaotischen „Lineal- und Bleistiftgrenzen“ ohne Rücksicht auf nationale Identitäten hinterlassen hatten. China hat sich jedoch im Inneren nach dem „langen Marsch“ 1948, der Kulturrevolution des Mao Tse Tung 1976 und der wirtschaftlichen Neuorientierung des Deng Tsao Ping einer neuen Dimension verschrieben, auf deren Weg sie die zurückgebliebenen und vom Westen ausgebeuteten und vergessenen Nationen nicht unterjocht, sondern mitgenommen haben: die Neue Seidenstrasse – eine Idee der weltweiten Kooperation, die die Eigensucht eines verwesenden Imperiums „America First“ sichtbar macht und wirtschaftlich überrollt:
Der Westen hat verloren – an Ansehen, an Glaubwürdigkeit, an Vertrauen: Demokratie ist in dieser neoliberalen Verfassung kein leuchtendes Ziel, die Menschenrechte in dieser Missachtung kein verlässlicher Massstab, das Völkerrecht nicht einmal mehr eine Empfehlung, geschweige denn, dass man diese Kriegsverbrecher Busch sen., Busch jun. Clinton, Obama, Trump auch nur ächtet, geschweige denn vor Gericht stellt. Es fehlt der „Westlichen-Werte-Welt“ nach Aufgabe von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ die Kraft, eine neue globale Idee zu befördern. „Demokratie, Freiheit und Menschenrechte“ sind nurmehr leere Hülsen und Kolonisationshilfen in einem militärischen Rammbock, der sich allein an imperialen Interessen und ökonomischen Profiten orientiert: Der Raubtier-Kapitalismus frisst seine Kinder !
Und dabei hatten wir einmal eine Idee, die die Gräben hätte verschütten können, Kapitalismus und Kommunismus in eine Synthese zu führen, Ost und West in ihren eigensten Errungenschaften zu respektieren und zu vereinen – der „Demokratische Sozialismus“, dessentwegen ich in die SPD ein- und bei dessen Verabschiedung durch die Agenda 2010 ich – zu spät – ausgetreten bin. Und wenn dass die Struktur im Innern, dann ist das „Friedensgebot“ der UN-Charta nach aussen die zweite Säule, auf der die Diplomatie Interkulturalität und Akzeptanz der Systeme anerkennen kann, ohne einen „Clash der Kulturen“ weiterhin durch unilaterale Interessenpolitik zu provozieren.
„Kaum ist man heimisch einem Lebenskreise und träge eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Abschied ist und Reise, kann lähmender Gewöhnung sich entraffen.“ – Hermann Hesse macht mir bewusst, dass Langeweile keinen Trost birgt. Und dennoch spüre ich Erschlaffen im immer gleichen Rhythmus. Auch unser Gespräch wird einsilbiger und tritt sich in den alten Spuren fest. Ich übe mich in Schweigsamkeit. „Gute Nacht, Freunde“ – begleitet mich Hannes Wader in die Nacht.
Tag 26 … Kreuz des Südens inmitten der Milchstrasse
0330 – der Tag beginnt eine Stunde früher. Auf der Fahrt nach Chile werden die Uhren wieder vorgestellt. Auf Aussendeck „F“ ergibt sich bei starken Winden ein Blick in die Nacht: Die Erhabenheit dieses Sternenzelts zusammen mit der Weite des Meeres im Dunkel der Nacht – eine Raum-Zeit-Erfahrung der Unendlichkeit in meiner Eindimensionalität. Das Kreuz des Südens lacht mich an.
„Also sprach Zarathustra…“ – Friedrich Nietzsche hat mich noch einmal in seine Höhle gelockt, aus der heraus er den Propheten und seinen Namen nutzt, um die eigene verächtliche Botschaft zu platzieren: Comedy, Kabarett – jedenfalls voller affektivem Zynismus und einer phantasievollen Orthografie, die alle Stilelemente des Erzählens nutzt, ohne dass sich ein Sinn aus dem Zusammenhang ergäbe, der mehr ist als nur ein Satz: “Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht“. Mit dieser Wucht prasselt seine existenzielle Philosophie auf dich ein, es ist, als ob er in trunkenem Zustand sein Diktiergerät bemüllt und es ihm überlassen hätte, die Satzzeichen nachträglich zu setzen. Wer erwartet hatte, mehr über die Zoroastrier zu erfahren, sieht sich enttäuscht: „Zarathustra“ ist und bleibt nur eine Metafer.
Noch 20 Stunden bis Puerto Angamos/Antifagusta – unserem vorletzten Hafen in Chile.
Nun schaukelt es wieder mächtig – die lange Welle des Pazifiks hat das Boot erreicht, der Fahrstuhl ist „out of service“. Sehnsüchtig gleitet mein Blick durch die Fenster meiner Kabine in die Weite – vor fünf Jahren lag am Ende der Reise „Auckland“; Gisela, Malcolm und Helen erwarteten mich. Nun erwartet mich niemand, schlimmer noch: Valparaiso ist kein Ziel mehr, sondern nur noch ein Ort auf einer Reise ohne Information durchs Ungewisse. Ich bin Gefangener meiner Selbst und weiss mich nur zu retten, indem ich mir immer wieder sage: Das Boot ist der sicherste Ort, vor dem Virus bewahrt zu werden. In Chile wie in Deutschland ist das öffentliche Leben, der Verkehr und wohl auch der private Umgang auf Eis gelegt; die letzten Nachrichten sagen, dass diese Vorsorge bis zum 19. April 2020 anhalten soll. Das tröstet. Was würde ich jetzt in Chile noch sorglos unternehmen können – immer das drohende Schwert über mir, als Ausländer in Quarantäne gesteckt zu werden, immer der Verdacht, der auf einem lastet, „ist er infiziert ?“, von der Ungewissheit einer Rückkehr per Flug gegenwärtig ganz zu schweigen. Insoweit sind die Verhältnisse an Bord eine Wohltat und noch geordnet, wenn ich davon absehe, dass ein Nachschub an Vorrat der Küche wohltun würde, manche Güter sind einfach „out“.
Noch neun Stunden bis Puerto Angamos. Die Nacht dreut, der Sternenhimmel versteckt sich hinter Wolken. Das Schiff rollt und wiegt mich in den Schlaf.
Tag 27 …Wüstenei Puerto Angamos
0830 – geschafft, mit leichter Hand streift „Jean Gabriel“ steuerbords an die gepolsterten Kaiwände, erschöpft nach 2 Stunden Einfahrt läuft das Anlegemanöver professionell ab: Leinen, Steg, Brücke. Wie aus dem Boden gestampft, die Hafenanlage in der weiten Bucht, Tanklager und Containerboxen auf der künstlichen Anhöhe, nur ein Kai mit vier leichten Liebherr-Kränen, überschaubare Lagerkapazitäten – und Schmauch und Rauch aus allen Rohren, die das Industriegebiet zu bieten hat. Die Crew hat Mundmasken angelegt, wir laufen noch frei `rum, sind Chile bis auf einen Schritt nah – und doch so fern, weil dieser eine Schritt nicht getan werden kann und darf. Nicht einmal Wehmut kommt auf. Das ist die im Alter entdeckte neue Gegenwart – positiv das Hier und Jetzt zu erleben, was ohnehin nicht geändert werden kann, wenn nicht die Neugier wäre zu wissen, was wäre, wenn…
Der Tag ist zu warm und die Arbeiten zu laut, um sich aufs Aussendeck zu begeben, die Kabine leise und heimelig – ein kleiner Streifzug durch die Bücher sei erlaubt: Michael Lüders hat in „Wer den Wind sät…“ noch einmal den Tenor unterstrichen, den Peter Frankopan in seinem historisch weiter gespannten Bogen bereits erarbeitet hat – ergänzt um die Palästinakatastrofe, die die Briten nach ihrer Balfour-Erklärung 1917 und dem Ende Ihres Mandats 1947 hinterlassen haben. Friedrich Schiller rührt mich in seinem Gedichtband immer wieder an mit seinen Balladen, von denen ich die „Kraniche des Ibykus“ sowie die „Bürgschaft“ besonders schätze. Aus Jean Jacques Rousseau`s „Gesellschaftsvertrag“ sind mir zwei Gedanken hängen geblieben: Zum Einen – eine Definition der „Gleichheit“: Keiner soll soviel haben, dass er sich einen anderen kaufen kann; keiner soll so wenig haben, dass er sich verkaufen muss. Und zum Anderen – die fatale Rolle der Religion im Kapitalismus: Wer die Menschen aufs Jenseits zu vertrösten versteht, macht ihnen die Sklavenarbeit im Diesseits erträglich. Rilke`s Liebesleben findet sich in seinem Gedichtband wieder und seine Worpsweder Freundschaft mit Heinrich Vogeler wird von Klaus Modick in „Konzert ohne Dichter“ in Anlehnung an das bekannte Bild hervorragend beschrieben. An Goethe`s Meister „Lehr- und Wanderjahre“ traue ich mich noch ebenso wenig ran wie an den Schinken von Fjodr Dostejewski „Die Brüder Karamasow“, die ich schon vor drei Jahren auf der Eisenbahntour durch Sibirien mal angefangen habe.
Rousseau, Morus, Locke und die übrigen Denker des Politischen haben mich zudem angeregt, mir selbst einmal mein „Utopia“ in ein paar Sätzen nach der eigenen politischen Erfahrung – parlamentarisch wie ausserparlamentarisch – zusammen zu tragen, die da lauten können:
1. Staat definiert sich allein im Gemeinwohl; die Würde des Menschen ist unantastbar. Staatsziel ist ein demokratischer Sozialismus, der allein dem Friedensgebot der UN-Charta zu dienen hat.
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus; seine Vertreter werden alle 5 Jahre mit Mehrheit in 800 landsmannschaftlich und territorial ausgewogenen Kreisen zum Bundestag gewählt.
3. Die Staatsgewalt ist geteilt in gesetzgebende, verwaltende und richtende Gewalt, die sich wechselseitig kontrolliert; keine Person darf gleichzeitig Mitglied in mehreren Gewalten sein.
4. Das Volk wählt als Repräsentanten alle 10 Jahre einen Präsidenten, der den Kanzler ernennt, dessen Regierung aus der gleichen Zahl von Abgeordneten jeder Fraktion gebildet wird. In die Regierung gewählte Abgeordnete verlieren mit dem Amtsantritt ihr Mandat. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
5. Die Regierung hat kein Gesetzes-Initiativrecht; sie verwaltet die Gesetze und vollstreckt sie. Die Länder werden landsmannschaftlich neu gegliedert; das Volk wählt Senatoren auf 5 Jahre in einen Senat, den die Regierung zu Regierungsvorhaben oder auf Anfrage des Landes öffentlich anhört.
6. Die dreigliedrige Verwaltung – Bund, Land, Kreis – orientiert sich an Bürgernähe in den Prinzipien der Mündlichkeit, der Dezentralisierung und der Vergesellschaftung des Staates. Sie wird in den Kreisen durch einen Direktor geführt, der für die Dauer von 10 Jahren gewählt wird. Allzuständige Gemeinden werden von Bürgermeistern selbstverwaltet, die sich alle 10 Jahre zur Wahl stellen.
7. Die Rechtsprechung wird durch unabhängige Gerichte ausgeübt. In den Kreisen werden ortsnah Friedensgerichte gebildet, die einen Streitfall binnen eines Monats nach Eingang der Klage kostenfrei mündlich erörtern und vergleichen, andernfalls den Rechtsstreit an die zuständigen Fachgerichte abgeben. Friedensrichter werden auf Lebenszeit durch die ortsansässige Bürgerschaft gewählt.
Die Präsidenten der Fachgerichte werden vom Volk auf die Dauer von 5 Jahren aus dem Kreis der Fachgerichte gewählt. Die weiteren Richter der Fachgerichte auf Lebenszeit werden auf Vorschlag der Regierung von Bürgerräten gewählt, die jeweils nach dem Zufallsprinzip erkoren werden.
8. Strafverfahren enden mit Einstellung oder einem Schuld- oder Freispruch; die Strafe wird nach einem fachlichen Interlokut vom Gericht festgesetzt. Die Strafe und ihr Vollzug berücksichtigen die soziale Kompetenz des Schuldigen und fördern seine Mitwirkung an einem straffreien Leben; der langzeitige Aufenthalt in geschlossenen Vollzugsanstalten ist wegen eines Rückfalls in die Kriminalität zu vermeiden. Die Anstalten spiegeln im Vollzug die Alltagswirklichkeit, die Gefangene erwartet.
Tag 28 die Südsee rauscht…
Kurz nach Mitternacht stösst die Jean Gabriel von der Kaimauer ab, die kleinen Kräne mit den beweglichen Trägern haben ihre Aufgabe anstandslos gemeistert und sich nach getaner Arbeit hochgeklappt; die Arbeitslichter an Bord gehen aus, „fertig machen zum Ablegen“. Langsam schieben die beiden Schlepper den schweren Kahn, eher erleichtert nach der Entladung, um die eigene Achse und schon steht die Bugnase wieder im Schwall zunehmender Knoten. Ich sehe Castor und Pollux.
Mein Blutdruck hat sich verstiegen – Grund wohl ist die Mail, die Arne Gudde an den Kapitän gerichtet hat, mich doch gefälligst anzuhalten, den Rückreisevertrag zu bestätigen und die danach fälligen Kosten möglichst schon jetzt per Kreditkarte zu überweisen, indem er ihm und der Crew gleichzeitig mitteilt, ich hätte mich geweigert, das Angebot des Rücktransports anzunehmen. Meine Antwort geistert mir schwer durch den Kopf, mein Blutdruck beruhigt sich nicht. Und das alles wegen 2.000 €. Von 0900 bis 1130 sitze ich am Computer auf Deck „U“ und zaubere eine Mail nach Strich und Faden, die er sicherlich im Büro aushängen wird – nun ist mir wohler. Ich bin – wie sagt man so schön – tiefenentspannt. Die See schlägt bei Wellen bis zu 3 m hart an. Der Aufzug ist „out of service“ – ein untrügliches Zeichen, dass es stürmt. Heute Mittag werde ich den verlorenen Schlaf nachholen.
Und gerade als ich soweit war, bat die Brücke uns nach oben: Rick hat uns das Internet eingerichtet – es wirkt wie ein Befreiungsschlag auch wenn es sehr langsam ist, aber die weite Strecke zum Satelliten will aufgebaut werden. Harald hat es offensichtlich schon lange, es uns aber nicht wissen lassen, sonst hätten wir längst ein paar Mails in die Welt senden können – ein bisschen Falschheit liegt in ihm, er öffnet sich deshalb auch nicht, ich gehe keinen Zentimeter zu nahe an ihn ran. Der Nachmittag verfliesst im Internet – besonders die Seiten über die Coronavirus-Entwicklung und – massnahmen interessieren. Merkel selbst ist in Quarantäne gegangen, ich habe ihr salbungsvolles Gerede über „jetzt sind wir alle verantwortlich“ gehört und „Bleibt zu Hause“, „Lasst die Omas und Opas allein“ streifen mein Gemüt.
Nachmittags frischt der Wind auf – ein 7er pfeift um die Ecken, bläst aber auch die Wolkendecke auf. Der Himmel wird blau, der Tag legt ein sommerliches Kleid auf – einer riesige Schule von Delphinen gesellt sich um das Boot, haben sich einen Fischschwarm aufgebaut, den sie genüsslich zerteilen, während sich die Vögel an den Resten guttun, die zu nahe an die Oberfläche geraten. Sie hinterlassen einen Strudel an Weisswasser, wenn sie sich in der Jagd tümmeln. Glenn auf Wache hat sie schon früh auf dem Radar entdeckt, sie werfen Radarschatten, so viele sind es diesmal. Und dann die Entdeckung: der deutsche Botschafter in Santiago organisiert für die gestrandeten Deutschen in Chile einen Flug Mitte der Woche – genau das habe ich vermutet und erwartet, dass Langsamreisen das organisiert, um seinen Reisevertrag zu erfüllen und auf die Gegebenheiten zu reagieren. Aber ich denke, wir bleiben auf dem Schiff, das ist für weitere 30 Tage der sicherste Ort: Noch 24 Stunden bis nach Valparaiso – ohne einen Schritt auf den Kontinent getan zu haben, auch ein berichtenswertes Nicht-Ereignis.
Tag 29 …das Ziel ist nah und doch so fern
0800 – und wenn wir nur einen Schritt auf südamerikanischen Boden tun, wird der Kapitän uns nicht mehr an Bord lassen. Erstens, weil wir Ansteckungsgefahr sind, und zweitens, weil wir keine Reise gebucht haben, und drittens, weil CMA CGM überhaupt alle Passagen von Südamerika nach Europa storniert hat. Also werden wir den Teufel tun, auch nur einen Schritt aufs Land zu setzen: Ein kleiner Schritt in die Menschheit, ein zu grosser Schritt für uns. Valparaiso – noch 12 Stunden! Steife Brise. Mein Ziel versinkt im Nebel, der an meinem Fenster abperlt. „Seltsam, im Nebel zu wandern…“
Und dann laufen sie doch wieder über die Wasser, die Gedanken, tauchen in jede Welle, gleiten und brechen sich in den Winden, die den Wellen Kronen verleihen. CORONA – eine Massenhysterie, ich höre, Menschenansammlungen nicht mehr als zwei, Körper-Distanz 1,50 m, Gespräche mit dem Opa nur per Telefon, Gisela in Haus-Quarantäne. Ich lese, wie wichtig ihr jetzt Heimat ist „zu Hause sein wollen“. Heimat aber i s t nicht, Heimat f i n d e t man, sie wartet irgendwo auf uns am Ende unseres Verlangens „hier zu sein – bei sich zu sein“. Ist es nicht vielleicht so auch – mit Gott ? fragt Rilke, dass er immer erst am Ende meiner Sehnsucht steht, dort wo alles sein Richten und seine Richtigkeit findet. Dass er immer eine Fiktion bleibt, eine Metafer für das Vollkommene gegen das Unvollkommene, das Unendliche gegen das Endliche, das Vollendete gegen das Unvollendete ? Wer weiss, ist er dann auch das Unbestimmte gegen das Bestimmte, damit sich alle an ihn klammern können – die Versöhnlichen wie die Unversöhnlichen, die Verwöhnten wie die Unverwöhnten, die Glücklichen wie die Unglücklichen, die Versehrten wie die Unversehrten ? Gott sei meiner Antwort gnädig.
Heinrich Vogeler und Rainer Maria Rilke lassen den Barkenhoff in Worpswede und Paula Modersohn-Becker wieder aufleben – ein Menschenfreund der eine, ein eitel besessener Geist und Schürzenjäger der andere – ich habe das Buch verschlungen, sehr lebendig geschrieben von dem Oldenburger Klaus Modick. Die Musik dazu liefert der ruhig dahin tändelnde Kahn, der sich auf „dead slow“ eingependelt hat – Ankunftszeit auf 0500 morgen früh verschoben, das sind ganze neun Stunden Wartezeit, ehe wir am „Ziel unserer Träume“ ankommen. Valparaiso – linker Hand im Dunst – hat einen Hafen, der aber ist für ein 100.000 BRT Containerschiff zu klein – und San Antonio lässt uns warten. Es dunkelt…
Tag 30 Traumziel erreicht – quasi
0600 – vor genau einem Monat habe ich mich in Wesseling auf die Socken gemacht, jetzt bin ich angedockt, aber nicht angekommen im Hafen von San Antonio, dem Container-Tiefseehafen für Valparaiso und Santiago. Kaum der Dusche entronnen, ruft Kim uns in das Büro des Kapitän‘s: Fiebermessung angesagt – negativ. Nach dem Frühstück müht sich Kim als officer on duty, meinen Laptop kompatibel zu machen, um mails versenden zu können; nach einer Stunde vergeblicher Liebesmüh‘ nutze ich den bordeigenen Computer, um eine mail an Gisela und Karsten abzusetzen. Ich denke, die positive Standortnachricht reicht, um Gewissheiten zu vermitteln – den Rest spare ich mir.
In der Tat – ein unvollkommenes Ende einer grossen Seefahrt, aber ein Glück im Unglück – wir sind auf einer Arche Noah, einer sicheren Insel – auf unserem Schiff. Wenn hier keiner erkrankt, sind wir Ende April möglicherweise über‘n Berg. Was sich als Manko abzeichnete, wird zum Rettungsanker, je mehr ich im Internet über das Virus und die Geschwindigkeit seiner Verbreitung lese. Und wer es wieder alles nutzt, um die Guten von den Bösen zu trennen. Wir haben seit der Privatisierungskampagne der Krankenhäuser die Ressourcen abgebaut, die Pflege personell entkernt und verwundern uns jetzt, dass der Kapitalismus mit den Katastrofen keinen Profit mehr machen kann – alle schreien sie nach Geld für den Risikoausfall. Und die Kampagnennachrichter sorgen dafür, dass der Ruf der Geschundenen nicht allzu laut wird, weil ja doch unsere Regierung sofort reagiert hat – mein Gott: mit welch unbestimmtem Zahlenmaterial – „infiziert“, „positiv getestet“, „Sterberate“: alles dürre Daten, aber starke Angstmacher. Mit Angst lässt sich halt gut regieren. Meine These bestätigt sich einmal mehr: Der Mensch lernt nicht durch Kopf, sondern nur durch Katastrofen – insofern ist das wieder ein historischer Moment – ein weltweiter 9/11. Mal sehen, wie altbacken wir aus dieser Situation herauskommen, nachdem Ebola, Schweine- und Vogelgrippe uns medial auch als existenziell bedrohlich verkauft worden, aber dann im Schlund der Vergesslichkeit abhanden gekommen sind.
Ich kann nicht leugnen, ohne Anspannung zu sein: Ich höre vertieft auf Signale des Körpers.