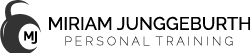01.03.20 Atlantik…Wie in Abrahams Schoss habe ich geschlafen – und als ich das Fenster öffne, jagt der Sturm in die Kabine. Er steht uns gerade auf der Nase mit 8 Bf. Und unser Kahn zieht ruhig seine Bahn mit 15 kn ohne Seitendrift. Draussen plustert sich der Anorak auf; kaum finde ich Halt, wenn ich nicht im Windschatten stehe. Regenschauer treiben das Wasser auf Deck F voran. Mächtig Verkehr auf der Route Kurs 265° West. 32 Wegpunkte hat der Navigator auf dem Weg nach Cartagena postiert. Die kleinen Fisch-Trawler sehen wie Spielzeug aus, sie haben Wegerecht theoretisch, „Jean Gabriel“ hält unbeirrt Kurs.
Heute leistet mir Augustinus Gesellschaft, der nach seiner Wandlung vom Lebemann zum Kirchenvater den „Gottesstaat“ begründet, in dem nur noch die „Gnade Gottes“ waltet – Luthers „sola fide“ nimmt hundert Jahre später den Gedanken wieder auf, während Albertus Magnus und sein Schüler Thomas verzweifelt zuvor versuchen, der Vernunft wieder einen Platz in der Theologie zu verschaffen: Augustinus prägt mit seiner empathischen Gläubigkeit an das Reich und die Gnade Gottes ein ganzes Jahrtausend spirituellen Stillstands in der Kirche. Die Welt ist schlecht, die Menschen gewinnen nur Halt in Gottes Gnade. Der Staat ist, wenn die Gerechtigkeit fehlt, nichts anderes als eine Räuberbande, die die erbeuteten Güter unter denen verteilen, die ihn beherrschen. Und ich sehe immer noch das Bild mit der kleinen Putte am Strand des Mittelmeeres, die ihm erklärt, eher werde sie sämtliches Wasser in diese Strandkuhle giessen, ehe er das Geheimnis der Trinität erkannt hätte – also lass das Grübeln: lebe, Junge.
Auf der Brücke verteile ich meine Ritter-Sport-Schokolade – quadratisch, praktisch, gut. Ein Espresso begleitet die weiteren Gehversuche in spanischer Konversation – so viel Nähe zum Italienischen, das manchmal die Laute verklingen, ehe das doppelte RR wieder seinen spanischen Tribut einfordert, bevor sich die Zunge an einer Pasta marinara labt.
Die Sonne verleiht den weissen Wellenkämmen Glanz, gelegentlich ein hauchdünner Regenbogen, der sich zwischen Wasser und Wolke klemmt. Die fünf, sechs kleineren Schiffe in der Nähe rollen ganz schön, während unser Bock sie alle stehen lässt. Rutger Bregmann feiert sich ab an seiner Trilogie an Utopien: Systemwechsel – a) Einkommen: bedingungsloses Grundeinkommen, b) Arbeitszeit – Verkürzung auf 15 Wochenstunden, c) Steuern: auf Kapital und Vermögen statt auf Arbeit. Ich bin begeistert, mit welcher Leichtigkeit er unzählige Quellen verarbeitet, um seinen Ideen und Argumentationsketten ein Fundament zu schaffen: Offene Grenzen nicht nur für Waren, sondern auch für Menschen – wir sparen uns jegliche Entwicklungshilfe. Ich werde ein „Rando-nista“, d.h. ich glaube keiner Verheissung, keiner Überzeugung mehr, wenn sie sich nicht daten-mässig empirisch belegen lässt.
Gesättigt von solchen Inspirationen nehme ich die Treppe hinunter auf Deck A, um mein Tagessoll an Tretarbeit zu absolvieren, die ich mit einem Saunabesuch kröne. Die Unterhaltung bei einem Kaffee nach dem Abendessen gerät zu kurz, um sich zu vertiefen – hier und da ein kleiner Snack, ein kleiner Seitenhieb auf Brexit und britische Eigenheiten – bis 2000 Fuss ein Hügel, darüber ein Berg: „Der Mann, der einen Hügel hinauf kletterte und von einem Berg herunterkam“ – schwirrt mir durch den Sinn und mein Anstieg 1977 auf den 3.000-er „Snowden“ in Wales, bei dem sich feet und meter verwechselten.
Nun bläst Rasmus von der Seite – und unser Bock beginnt zu stampfen und zu rollen: stürmische Zeiten: Ich tagträume Bilder von Valparaiso – „Tal des Paradieses“, frei übersetzt. Und immerhin – schon Weltkulturerbe seit 1995.
02.03.20 Es bläst und plästert…. „Winterstürme wichen dem Sonnenmond“ – ich weiss ohne Wikipedia nicht einmal, wem ich diese Zeilen zuschreiben soll, aber es war mein erster Gedanke, als ich in neuer Zeitzone gegen 0400 plötzlich aufschrecke: Die Tür zum Kühlschrank klappt auf und zu, das Wasserglas rollt auf dem Boden auf mich zu und der Schreib-Drehstuhl tanzt auf der Stelle. Schwarz die Nacht, der zunehmende Mond hinter den Regenwolken versteckt. Wenn sich eine Welle an der Bordwand bricht, ruckelt und zuckelt das ganze Mobiliar; es treibt die Gischt an mein Fenster. Der Versuch, aus dem Bett aufzustehen, bleibt erfolglos – erst wenn sich das Schiff nach Steuerbord neigt, werden meine Hebelkräfte unterstützt und ich stürze in die Richtung, um mich an irgendeinem Stück Möbel festzuhalten. Das hört sich nach Orkan an; Glenn ist auf Wache, er wird den Kahn ein wenig aus dem querab einfallenden böigen Winden gegen den Schwall drehen, um das Rollen des Schiffs nach beiden Seiten nicht über 10 Grad wachsen zu lassen. Aber 10 Grad Steuerbord, 10 Grad Backbord alle 10 Sekunden – ich kann euch sagen, es bläst sehr.
Türen und Stühle gesichert, alle beweglichen Teile verstaut – im Bett lässt sich flach die Schaukelei am besten ertragen, die mich an die Überfahrt 2006 der Drake Passage in die Antarktis erinnert, wo die kleine „Alexander von Humboldt“ sich gar 15 Grad zu beiden Seiten rollte: Das See-Abenteuer nimmt seinen Anfang – und ich mir eine Prise Schlaf in gesicherter Seitenlage. Erst jetzt bemerke ich, dass das Bett seitlich Sicherheitsleisten eingebaut hat, die einen Ausfall aus dem Bett verhin-dern sollen. Reichlich unausgegoren schaue ich gegen 0730 aus der Wäsche und entschliesse mich, heute mal auf das Frühstück zu verzichten, zumal der Fahrstuhl bei dieser Seelage seinen Betrieb eingestellt hat und der Abweg über die 8 Treppen über vier Decks nur beidhändig sicher erfolgen kann.
Das Anziehen fällt schwer unter diesen Bedingungen, weil du ohne Sitz keinen Halt verspürst und Massen sich halt nach Massengesetzen bewegen. Also ran an Al-Farabri, Abu Bakr, Ibn Sina/ Avicenna und Averois – jene muslimischen Denker und Philosophen, die mit ihrem aristotelischen Denkansatz und dem Vorbild Mohammeds Religion und Recht in einen „vortrefflichen Staat“ mit einem „vortrefflichen Herrscher“ einbetten und Religion und Philosophie nicht – wie bei Augustinus – ineinander verfliessen lassen. Ihr Einfluss und ihr Verständnis ist so kurz geraten wie die Seiten im Buch. Stattdessen nimmt Thomas von Aquin, der Schüler des Albertus Magnus in Köln war, den Raum eines intellektuellen Kirchenlehrers ein, der sich der Versalbung von Religion, Philosophie und Gesellschaft durch Augustinus‘ „himmlisches Jerusalem“ versagt.
Versagen tut sich auch mein Kindle e-book, wenn ich es in die Bibliothek zurückführen will – offensichtlich ist nach fünf Jahren – oder sind es schon zehn – die Sollbruchstelle schon erreicht. Mittags stärkt uns der Messman Joe mit einem bulligen halben Hähnchen, ehe uns um 1600 Glenn eine zweistündige Führung durch sein Wheelhouse gewährt, während er Wache auf der Brücke schiebt. Meine Mitstreiter haben die Brücke und ihr Interieur noch nicht häufig gesichtet – NSA liest mit, weil seit 9/11 alle Schiffe auf amerikanisches Drängen eine Kennung führen müssen mit Namen, Identifikationsnummer, Schiffsart und Destination. Nachdem nun CMA CGM alle Schiffe in China bauen lässt, werden auch die Chinesen genug Insiderwissen erhalten, um es den Amerikanern gleich zu tun – und aufgezeichnet auf der Blackbox bleibt sowieso jedes Wort, das auf der Brücke gesprochen und für die Versicherung auf fünf Jahre aufbewahrt wird.
Schweinebraten und Brechbohnen schaffen die Grundlage für jene Tasse Kaffee, die unsere Unterhaltung über Gott und die Welt trägt – und am Ende der Reise erhalten wir dann die frohe Botschaft: Trump ist über eine Sexaffäre gestolpert, Johnson als Clown in den Staatszirkus gewechselt, UK wird wieder EU, Netanjahu von einem Palästinenser ermordet und Angela Merkel hat angesichts des Chaos in der CDU hingeschmissen: In Deutschland stehen Neuwahlen an.
… man wird ja doch noch träumen dürfen – Aufwachen muss man ja ohnehin.
03.03.20 Wie ein Hammer… bläst der Wind nun mit nahezu 100 km/h gegen „Jean Gabriel“, Gott sei Dank – von vorn. Damit hat das schwere Rollen sich getauscht gegen ein heftiges Stamp-fen, mit dem der Bug 6 und 8 m tief in die Wasser eintaucht und die Gischt hoch über die Con-tainerboxen schiessen lässt: Der Atlantik zeigt sein stürmisches Gesicht. Die Wellen sind gegen gestern von 6 m auf 4 m gefallen und dank der Windrichtung aus Südwest stechen wir auf Kurs 240 mit 20 kn durch die See. Fein säuberlich wird das Logbuch mit diesen Daten von Hand geführt wie ein Gerichtsprotokoll, woran nichts mehr verändert wird, aber ansonsten ist Glenn auf verlorenem Posten: Kein Schiff in Sicht, unsichtiges Wetter, raue See – ein Traumjob ist es noch nicht als Wachoffizier 4 Stunden allein durch das Wheelhouse zu laufen. Sein Redebedarf ist auch gering, so dass ich mit ihm nach Ende der Wache die Brücke um 0800 verlasse, nachdem wir die Uhren wiederum um eine Zeitzone zurückgestellt haben.
Die mächtigen Portionen zu Mittag und Abend erleichtern auch heute wieder, auf das Frühstück zu verzichten. Stattdessen öffnet Carmen das Buch für die zweite Lektion Spanisch, die nun mit den unregelmässigen Verben „ser“ und „tener“ erste Lernerfolge zeitigen; dank der lateinischen, italien-ischen und französischen Vorgaben erschliessen sich die Worte und ihre Bedeutungen sehr schnell, allein die Aussprache bei „c“ und „g“ und „z“ und „j“ sucht noch nach Haltepunkten. Aber auch das wird Carmen bis zum Ende der Reise noch schaffen.
Ottfried Höffe verführt mich einmal mehr in die Schule des politischen Denkens – heute hat er sich mit Dante Alighieri mal keinen Philosophen oder Kirchenlehrer, sondern einen Poeten ausgesucht, der mit seiner „Göttlichen Komödie“ einen globalen literarischen Bogen von der Antike in die Gegenwart spannt und sich dabei in Florenz so unbeliebt macht, weil er im Zweifel die Macht mehr in Rom als bei den Fürsten der Städte sieht. Anders als der mir unbekannte Marsilius von Padua, der sich vehement gegen die „zwei Schwerter“ Roms wehrt und den weltlichen Herrschern das Ihre und Rom das Seinige gibt. Dafür wird er als Häretiker mit Kirchenbann belegt und vogelfrei gegeben; er flieht – nach Bayern zum Landesfürsten Ludwig, der ihn ebenso wie William von Ockham gegen die Nachstellungen der Dominikaner in Schutz nimmt; in München liegt er begraben.
1100 beginnt meine Zeit auf der Brücke – Kim wuselt schweigsam in den Papieren; mein Hochsitz wackelt bedenklich im Stampfen. Hier oben scheint das alles wundervoll beherrschbar. Und das bei laut schwirrenden Winden von nicht weniger als 10 Bf – ein Hammersturm, orkanartig.
Picata Milanese und einen kalten Spinat heisst es diesmal zu vertilgen – bei den Offizieren geht das im touch and go -Stil, während wir vier uns wunderbar eine Stunde Zeit lassen, um uns an den frischen Salaten, der reichhaltigen Suppe und den Trauben zum Dessert zu delektieren. Ein Rund-gang ist bei diesem Wetter ohne Sicherheitsleine nicht denkbar, also bleibt es bei der guten Übung einer Tasse schwarzen Kaffees – mit anschliessender Ruhepause. Ein Blick in den Reiseführer lässt erste Bilder von Chile und der Route entstehen. Das ist das Geheimnis der langsamen Reise – du bleibst stets Herr der Reise; Goethe muss es auf seiner Italienreise ähnlich gedacht und erlebt haben.
1700 Uhr läutet den zweiten Brückenbesuch ein, nicht ohne von dort gedanklich einen lieben Gruß an Juffes zu seinem 81. Geburtstag zu telepathieren. Der Vorhang an Dunst hat sich langsam gehoben, der Wind bläst unverändert von vorn. Morgen lässt er vielleicht etwas nach – aber unser Kahn lässt sich doch von so was nicht beeindrucken. Tagaus – tagein immer 20 kn, das sind am Tag bei 24 h insgesamt rund 850 km. Und dieses Quantum ununterbrochen über 10 Tage – Respekt.
Der Abend neigt sich, Harald verschweigt sich, obwohl er viel zu erzählen hätte – gestern fand ich ihn mit seinem Sextanten auf dem Deck, als die Sonne Gelegenheit gab, die Longitudinale zu be-rechnen. Ian ist ein Huckepack, der täglich seinen Lauf auf dem Laufband macht, während er im Kindle liest. Und Wolfgang ist ein Strahlemann, der immerzu laut lacht, ohne dass seine Erzählung das hergibt: mit seinem Lachen und der Gestik überspielt er sein Wortdefizit – ein guter Kerl.
04.03.20 Auf dem Sonnendeck… hätte ich liegen können bei 17 ° Aussentemperatur, wenn der kühle Wind nicht wäre, der mich immer noch mit 6 – 7 Bf an Deck anbläst und weisse Gischt-schwaden quer über den Kahn und seine Boxen bis zur Brücke schickt, wenn der Bug bei den lang gewordenen Wellen mal wieder in eine grosse Gegenwelle platscht; dann zittert und zuckelt das ganze Boot und es wirft einen fasst vom Hocker. Sonnenbrille und Sonnencreme liegen jedenfalls schon mal bereit, nachdem wir gegen Mittag die Azoren in Sichtweite von Flores passiert haben.
Ein erfolgreicher Tag, der uns mit den beschwingten Wellen endlich eine gute Fahrt vorgaukelt. Ein guter Tag, nachdem nun endlich der Blutdruck auf die Lowcarb-Essen reagiert. Fröhlich habe ich registriert, die 64 Stufen zwischen Messe und Kabinendeck in einem Anstieg gemeistert zu haben, um oben angekommen schnaufend zu verweilen, den Sauerstoff nachzuziehen, der mir fehlt, um mit meinen Kumpanen gleich zu ziehen. Zähle ich die 46 Stufen zur Brücke noch dazu, vermag ich mein Glück kaum zu fassen.
Glück habe ich auch, weil Kim, der Wach-Offizier, mir das Kindle-Buch wieder richtet, so dass ich nun endlich Oswald Spengler „Untergang des Abendlandes“ aufrufen kann, ein Schinken, der im ersten Weltkrieg entstanden, aber aus den Nöten der Nachkriegszeit erst 1922 veröffentlicht worden ist und der westlich-amerikanischen Zivilisation den Untergang bereits vor hundert Jahren prophe-zeit hat. Allein die Einleitung macht in ihrer Begeisterung, mit all den schwächelnden Philosophen von Nietzsche bis Hegel, mit Leibniz und Kant abzurechnen und sich dem Pragmatismus eines Goethe zuzugesellen, einen Stundenblock aus.
Derweil krönt auf dem anderen historischen Pflaster Nicolo Macchiavelli mit seiner florentinischen Abrechnung „Il Principe“ die italienische Renaissance: Politik ohne Moral, allein der Macht verpflichtet – ein Opus, das von den Erfahrungen mit den mächtigen Familien der Medici berichtet. Ob als Glosse oder als Handlungsanweisung lässt der Betrachter offen – ich werde es mir antun.
Erste Vorstellungen über einen gemeinsamen Weg vom Ankunftshafen San Antonio nach Valparaiso werden mit Wolfgang erörtert; ich plane in 2 Tages-/3 Nächte Abschnitten an 12 Punkten von Valparaiso bis Buenos Aires, wenn ich mal von den Sonderpassagen zur Osterinsel und nach Kap Hoorn absehe. Und meine Freude an der spanischen Sprache gewinnt Zulauf, wenn das RR immer stärker rollt – wie das Boot, das den Wind wieder von der Seite tankt und meinem Schritt unge-wollte Dynamik verleiht.
Nie sehe ich Glenn, Kim oder Rick – die Filippinos -, in der Offiziersmesse; das ist eine Domaine der „alten weissen Männer“ aus Kroatien, auch wenn sie noch so jung sind – ein wenig Rassismus auf dem Boot gefällig oder brauchen die jungen Filippinos ihre Landsleute, die die Mannschafts-messe beherrschen ? Aber das können sie doch auch in ihrer Freizeit. Wie lob‘ ich mir die „Puget“ mit meinem Captain Dragon Radic gegenüber dem abweisenden Klima, das die Offizierscrew auch uns gegenüber verbreitet. Ich hatte beim Chief-Officer – immerhin der zweite Mann an Bord – nachgefragt, ob es nicht mal ein gemeinsames Gespräch mit den Passagieren gäbe, wir fühlten uns einigermassen isoliert; seitdem ist die Tür zur Offiziersmesse zu. Na, immerhin haben wir eine lustige, ernsthafte Runde.
Beglückt, bedrückt und erschöpft sinke ich in die Nacht, die mir wiederum eine Stunde im Wechsel der Zeit schenkt.
05.03.20 Azorenhoch… Erfrischend die Dusche und der Morgenspaziergang auf Deck F. Der Bio-Rhythmus spielt noch ein wenig verrückt, wenn er mich schon um 0500 wach macht, aber da mich noch Dunkelheit umgibt, lass‘ ich mich noch ein wenig schaukeln. Die Wasser sind ruhig, aus Südost weht ein 6-er, das Schiff schneidet die Wellen ohne allzu grosses Stampfen und macht seine 20 kn, Cartagena steht jetzt schon für den 10.03.20 1320 auf der ETA-Liste.
Das Frühstück reduziert sich auf ein Omelett mit Bacon und ein Joghurt mit Meli – der Blutdruck hat sich nun wohlig bei 130 : 80 eingependelt: Der Spanischunterricht der dritten Lektion kann beginnen – die Konjugation von „leer“ und „hacer“ stehen an; es läuft rund.
Nach „Old Nick“, dem Teufel Machiavelli, heute nun das britische Pendant Thomas Hobbes, der sich – anders als sein französisches Pendant Descartes – brachial auf die Seite der Throne schlägt, Presbyter, Puritaner und Katholiken aus Sicht der anglikanischen Kirche bekämpft und auf dieser Basis den Staat hochhält, denn ohne Staat – d.h. ohne Recht und Politik – würden Gewinn-, Ruhm- und Herrschsucht die Menschen zu Wölfen werden lassen: „homo homini lupus“. Mit dem biblischen Ungeheuer Leviathan greift er zu einem wirkmächtigen Bild, in dem der König mit Schwert und als Oberhaupt der Kirche von England auch mit dem Bischofsstab regiert: Der König ist das Volk – „l‘etat, c‘est moi“: der Absolutismus hat seinen Lautsprecher gefunden. Nicht die Wahrheit, Autorität ist gefragt. Wie lobe ich mir den Rationalismus bei Spinoza, der zur gleichen Zeit einen Hauch bürgerlicher Freiheit und erste Klänge der Aufklärung vermittelt: zu denken, was man will und zu sagen, was man denkt. Aber die Briten waren schon immer anders.
Auch Spengler schneidet boshaft und flattrig aller Welt vor ihm das Wort ab und sieht die westliche Zivilisation als der Kultur entwachsen. Ich mag seiner Vermessenheit in Gedankenspielen und Worten noch keinen Reiz abzugewinnen; er gibt Antworten, ohne dass ich um seine Fragen weiss.
Ich fliehe – mit meinem spanischen Wörterbuch auf die Brücke. Aber Kim ist auch heute nicht eben launig. Es herrscht eine kühle Atmosfäre an Bord – wie in einem Nebel weichen die Menschen einander aus. Immerhin schmeckt der Kaffee mit ein, zwei kleinen Keksen. Nach dem Mittag finden wir uns um 1500 unerwartet alle auf dem Bug – ich habe meinen ersten Rundgang auf der 300 m Strecke erfolgreich hinter mich gebracht, den kräftigen Schlag der Schraube ebenso bewundert wie die Grösse der Glieder in der Ankerkette. Die Mannschaft beginnt unter den herrschenden Wind- und Wetterbedingungen das Salz abzuwaschen, das sich auch aggressiv in meine Handschuhe frisst, die ich zum Schutz neben gelber Weste „CMA CGM“ und Helm angezogen habe. Einen Platz im Bugkorb traue ich mir noch nicht zu – zu ungeschickt würde ich mich vor den Augen der Passagiere bewegen. Die Abwechslung nach den Tagen voller Sturm und Regen tut gut – die Gesichter strahlen. Schäfchenwolken schleichen sich ein und kündigen dem Kundigen aber wieder einen Wetterwechsel an, den wir auf 239 ° WSW unterlaufen.
Sei‘s drum – wir sind auf Grosser Fahrt: Morgen ist ein neuer Tag.
06.03.20 Ein Hauch von Frühling… umweht uns; eben noch wetterfest im gefütterten Anorak laufen wir jetzt im T-Shirt und setzen Wolfgang auf Deck F nach, wo er einen kleinen Plastik-Pattevogel in den Wind sausen und zerzausen lässt.
Derweil lockt John Locke mich als Antipode von Hobbes mit seinem Anflug religiöser Toleranz und seinem politisch-ökonomisch inspirierten Liberalismus in ein neues bürgerliches Weltbild, das sich erkenntnistheoretisch auf den Empirismus stützt. Er nimmt erstmals vor Kant einen Fundamental-imperativ mit seinem Schädigungsverbot auf: „ Keiner schädige den anderen!“ und antizipiert Elemente der Aufklärung mit den Grundgütern (-rechten) jedes Bürgers „Leben, Freiheit und Besitz“. Damit erteilt er dem Seelenheil aus staatlicher Hand eine Klatsche – und verachtet zugleich die Katholiken, die im Papst immer noch ein religiöses Oberhaupt und Rechtsverweser ihres bürger-lichen Handelns sehen. Noch vor Rousseau vereint er Natur- und Menschenrecht in einem „Gesellschaftsvertrag“: Arbeit ist der wichtigste wertschaffende Faktor – und mit den Werten einher geht „Mein“ und „Dein“: Bürger schaffen sich mit diesen Wert ein personales Gesicht, wobei die Herrschaft des Eigentums nicht angerührt, sondern als Stabilitätsfaktor in den Gesellschaftsvertrag eingebracht wird. Gewaltenteilung, Legalitätsprinzip und Widerstandsrecht gewinnen an Fahrt in die Aufklärung eines Montesquieu und Voltaire, während Locke sich für seine frevlerischen Gedan-ken und anonymen Abhandlungen nach Cromwell‘s Tod vor dem Absolutismus des Königs fürchten muss.
Mein Spanisch gewinnt an Worten und Stärken, ich suche nach Gelegenheit mit den Filippinos spanisch ins Gespräch zu kommen, aber sie sprechen ihr tagalo, allenfalls rudimentär noch spanisch, die meisten nurmehr office-englisch. Der Versuch, unter Meditationsmusik zu lesen, scheitert, weil ich zwar die Kassette, nicht aber die CD eingepackt habe. Jo wechselt die Linnen und putzt das Bad, Staubwischen hat er nicht gelernt; er bleibt seltsam stumm mit seinem Sprachfehler.
Die Gespräche am Tisch nehmen Form an; Ian erzählt ausführlich über die Rolle der Monarchie und ihrer Bedeutung für die britische Identität; die Deutschen haben keine Identität stiftende Person. Wolfgang schildert seinen Umgang mit dem Sterben seiner Frau vor zehn Jahren und Harald demonstriert seine Kunst am Sextanten – ein lebendiger Kreis, der als erster zu Tisch geht und als letzter vom Tische aufsteht, um in der eigenen Messe zu Mittag wie zu Abend noch einen Absacker zu finden. Um 1600 lässt der Kapitän einen „allgemeinen Alarm“ – „sieben kurz, einmal lang“ – übers Schiff auslösen: Mit Helm und gelber Weste stellen wir uns der Brücke vor – ein Drill und ein Danke, das war‘s dann: Die Zeit läuft mir einfach so davon.
07.03.20 Hoi, a Schiff… ein Segelschiff – Ketsch auf Kurs Horta/Azoren -, ein Flugzeug, ein paar fliegende Fische: schon ist der Tag gerettet. Und er hat früh begonnen.
Der Vollmond lässt sein fahles Licht in meine Kabine fallen und nimmt mir eine Rechtfertigung für weiteren Schlaf, also auf, du Abenteurer, einmal kalt durchs Gesicht, Blase entleeren, Tabletten, um den Blutrausch der Nacht abzumildern, der am Ende des Tages bei schlichten 139:80 endet – und ab auf die Brücke.
Dunkel umfängt mich, Vorhänge vor den Lichtern an den Kartentischen, lediglich die Geräte laufen – sprachlos wie Glenn und sein Look-out, die nicht einmal eine Antwort wissen auf mein morgend-liches Angebot um 0430 : „you need company ?“ Eine seltsam dumpfe, kühle Atmosfäre herrscht, kühl ist es ohnehin im Wheelhouse dank der Luftkühlung, Glenn trägt Kapuzenpullover mit über gezogener Kapuze. Also setze ich mich verstohlen – verbotener Weise – auf den Lotsenstuhl und lasse die Stille der Nacht an mir vorbeirauschen. Keine Frage, kein Wort – eine seltsame Art der Kommunikation in der einsamen Langeweile der Nachtwache. Grusslos verlasse ich um 0630 jenen Raum, der eigentlich in seiner Auslage für die Weite der Welt, den nie endenden Horizont und den technischen Fortschritt steht, der allein in meiner Zeit seinen Segen für die christliche Seefahrt erbracht hat.
Zum Ausgleich verabrede ich mich mit Wolfgang, meinem schwäbischen Bäuerlein – der „alles kann ausser hochdeutsch“- auf dem Bug. Sauber sieht es nun aus, nachdem die Mannschaft den Umweg gesäubert und von der Salzschicht befreit hat. Die Vorstellung von Leonardo di Caprio und Kate Winslet auf der Titanic locken uns in den Bugkorb. Erst werden die Fotos verschossen – und Wolfgang zählt seine schon in die Tausende – dann endlich bleibt nur der Wind, der in die Stille des Ortes rauscht – Schweigen ist angesagt, schweigen ob all der Gedanken, die kreuz und quer versuchen, den Moment einzufangen: „Augenblick, verweile, du bist sooo schön“.
Die Luft ist angewärmt, ein Hauch von Frühling zieht übers Boot, die Sonne setzt ihre Strahlkraft ein, um uns den Rücken zu wärmen, während der Fahrtwind – schneller als der wahre Wind von 4 Bf – uns die Nasen kühlt. Erst als wir uns schon wieder im Windschutz des Bugs befinden, findet sich unser kroatischer Kapitän aus Rijeka zufällig bei einem Kontrollgang ein. Mit einem etwas verqueren Lächeln vermittelt er uns, dass bei diesen Wetterkonditionen wir nicht in voller Montur – Schutzhelm und Weste – laufen müssen, na ja – er trägt selber weder Helm noch Weste. Es herrscht absolutes Alkoholverbot an Bord – und die Liste der Verkaufsgegenstände weist die unterschied-lichen Sixpacks für „Beck‘s“ und „Holsten“ aus. Es herrscht absolutes Rauchverbot an Bord – auf den Zimmern stehen Aschenbecher und der Kapitän schmaucht selbst auf der Brücke. „Englisch ist die Bordsprache auf der Jean Gabriel“ – leuchtet es in schwarz und rot papieren auf allen Fluren, aber der kroatische Tross der Offiziere spricht nur serbokroatisch, die philippinische Mannschaft ihr heimisches tagalo – einzig die Passagiere halten sich an den Codex und sprechen englisch, sehr zur Freude von Ian, der als Anwalt der Krone keine andere Sprache spricht.
Für einen Augenblick durchzieht mich der Gedanke, das abendliche Barbecue aus Protest zu bestreiken gegen diese Doppeldeut- und Einseitigkeiten – „Crew“ heisst Mannschaft, in der wir jetzt als Nummer 29 – 32 gelistet sind, aber von Mannschaftsgeist weit und breit nichts zu spüren. Selbst Wolfgang fällt nun auf, wie abweisend ihm Rick auf der Brücke begegnet ist. Und die gelebte Apartheid zwischen Kroaten und Asiaten – ich vermeine, eine westliche Arroganz auch in dieser Ungeste wahrzunehmen. Und unsere „splendid isolation“ als Passagiere – Gastfreundlichkeit an Bord liest sich anders. Die Unwilligkeit, mit uns auch nur Kontakt aufzunehmen – von der bisher trotz Bitten unterbliebenen Einladung in die Maschine ganz zu schweigen – bestärken meinen Mut. Also, Junge, zeig dein Gesicht !
Rousseau – „Frei geboren und doch in Ketten“ -, jene Ausgeburt an Aufklärung, die mit ihrem „Gesellschaftsvertrag“ mir den Grundgedanken jeder Volkssouveränität durch Demokratie gelegt hat, gerät zur verbalen Enttäuschung. Mich fasziniert zwar seine lebenslange Unruhe, die ihn aus den beschützten Verhältnissen seiner Ständerepublik Genf/Schweiz in die universelle Welt des Aufbruchs in die Moderne nach Paris führt, mich spricht an seine mit brillanter Feder geführte gnadenlos radikale Zivilisationskritik – wie ich sie mit meinen „Momentum“ zu betreiben suche -, die den ungerechten Staat und die Herrschaft des Privateigentums als Ursünde betrachtet. Mir gefällt auch noch in seinen Grundsätzen des Staates („direkte Demokratie“- keine Repräsentanz, wohl eine Schweizer Eigenheit) zwischen politischer und natürlicher Freiheit zu unterscheiden und dem Gemeinwohl den Vorrang vor dem Eigenwohl zu geben. Dort wo es ernst wird, sich die Gewalt zu teilen, verwehrt er sich und verweist die Demokratie in die Ferne eines nie erreichbaren Ideals: eine vollkommene Demokratie sei für den Menschen nicht geeignet, das sei Sache der Götter.
In der Folge der Ernüchterung gebe ich mich dann auch noch dem „Fürsten“ hin, den Machiavelli seinem „Lorenzo de Medici“ in Florenz widmet und ihm die fürstlichen Tugenden „gerechte Gesetze“ und „gekonnte Kriegsführung“ am Beispiel der vielen Nachbarschaftskriegen in Italien zur Zeit der Renaissance unter dem Einfluss des Papsttums nahe bringt – eigentlich alles verständ- lich aus dem Geist absolutistischen Denkens und Handelns. Welch ein Aufhebens in der politischen Diskussion – unbrauchbar letztlich für einen Staat, der nicht mehr absolutistisch regiert wird. Aber von der Sorte wachsen ja wieder mehr und mehr in den Horizont meiner Wahrnehmung: In den Ländern, die nie von „Aufklärung“ gewusst, geschweige denn profitiert haben – wie China, Russland, Afrika, Arabien. Oder von ihr gehört, sich aber mangels Repräsentanz gehörig abgesetzt haben – wie die Amerikas. Und selbst in unseren Breiten zeigt sich mit den Orbans, Kaczinskis, Erdogans, Johnsons wieder jener „Good Guy“, der dem Volk verspricht, autoritär von oben alles besser zu richten; der Neoliberalismus hat es zum System verfeinert. Wohl denn: Der „wohl wollende Herrscher“ als Alternative zur Volksherrschaft, wenn er denn gerecht ist und soziale und politische Gleichheit unter Kontrolle hält – aber ist das denn noch machiavellistisch ?
Ich trage den Gedanken in den Gymnastikraum, um mich auf dem Fahrrad, dem Laufband und an den Geräten zu entspannen, ehe ich mich den 45 ° Hitze in der Sauna aussetze, die ich wohl als einziger auf diesem Schiff benutze. 1750 – ich habe mich für den Barbecue sonntäglich gestylt, werfe einen kühnen Blick auf die vielen Arbeitsbienen auf Deck G, wo es kräftig durch die grossen Ritzen weht, um mich dann auf meinen Protest zu besinnen, von dem niemand Notiz nimmt: 1800 ich streike – auf der Kabine; 1810 – ich streike immer noch. Hat da etwa jemand geklopft ? 1820 – la lutte continue. Ich habe doch keine Extra-Einladung für das Barbecue erhalten – oder ? Und überhaupt – dann fällt ja heute das Abendessen aus. Aber das ist doch schon bezahlt. Dann lohnt sich der heimliche Protest ja gar nicht, wenn die Bahnsteigkarte schon gelöst ist. Jedenfalls singen werde ich zur Freude der Crew nicht, auch kein Gedicht in deutsch vortragen, das ohnehin niemand versteht. Übers Aussendeck gibt es doch auch noch einen verstohlenen Weg auf Deck G ?
Windzerzaust erscheine ich in dem martialischen Getöse des Fahrtwinds, der voll auf den Aussen-tischen steht – den geschützten Innentisch haben sich die alten weissen Herren aus Kroatien gesichert, die der Stärke des Windes die Stärke ihrer Stimmbänder hinzufügen. Wie erwartet hocken die Filippinos im Wind eng aufeinander, das Gedränge am Grill ist bereits abgeebbt – die Fleisch- und Fischbrocken, die Bratwürste und der Bauchspeck werden neben den kleinen Cevapcici tellerweise aufgeladen, eigentlich kein wirklich einladender Ort: Meine Kumpane sitzen verloren auf einer Extrabank, Wolfgang strahlt, er hat eine Dose „Beck‘s“ ergattert. Ich entscheide mich für Miesmuschel und Crevetten – aber das ist ja alles roh. Und ein so versierter Grillmensch bin ich ja auch nicht. Also schau mal, wie es die anderen machen: Das Wasser in den Muscheln kocht sich das Fleisch – ok; die Crevetten vertragen die Glut auch auf der zweiten Seite – geschafft. Und am Tisch der Offiziere ist auch noch Platz, der mir freigegeben wird. „Das ist alles ?“ fragt der Kapitän angesichts meiner Schmalkost. Aber dann hört das „Gespräch“ auch schon auf, denn allenthalben krachen kroatische Böller links und rechts in mein Ohr, die den Fahrtwind zu übertönen suchen. Hier ist kein Platz für mich. Ein Schlag Fruchtsalat – und ich ziehe mich ab von Deck G. War das ein geharnischter Protest – die Jungs haben gesehen, was ein 68-er noch alles so drauf hat ! Punkt,
Ein Absacker will uns in der Ruhe unserer Deck F Messe auch nicht mehr gelingen – wieder ein Tag verbraucht.
08.03.20 Auf Kurs… 063 ° W 23 ° N zeigt das GPS an – wie die Meilen verfliegen: Jeder Grad hat 60 Minuten und jede Minute zählt eine nautische Meile, sprich 1,8 km, das sind 108 km pro Grad, d.h. wir sind vom Meridian in Greenwich bereits mehr als 6000 km nach Westen gefahren – und Hamburg liegt noch mal ein paar hundert Kilometer östlich. Und jetzt geht die Mathematik los: Wir segeln ja nicht einfach nach Westen, sondern in südwestliche Richtung von Hamburg auf etwa 55 ° N nach Puerto Rico auf etwa 20 ° N – dann bleibt nur die Rektante im Kräfteparalello-gram: wer schafft das noch ausser Harald, der wohl sein Geld als Mathematik- und Physiklehrer verdient hat. Rechnet man ganz einfach mal 9 Fahrtage auf dem Grosskreisbogen x 24 Stunden à 18 kn = 3.888 nm und schmeisst die paar Meilen bis zur Passage von Hispaniola und Puerto Rico noch dazu, dann sind wir morgen schon 7.200 km unterwegs, 1/6 des Erdballs – mein Gott, welche Dimensionen. Und genau jene Änderung spüre ich in diesen langen Tage auf See – die Dimensionen haben sich verändert: Weite hat ein anderes Gesicht; Wetter hat ein anderes Gewicht. Kaum, dass sich die Sonne traut, uns zu wärmen, schiebt sich eine Depression dazwischen und schenkt uns Klatschregen, der aber nun schon karibisch warm ist.
Sonntag ist. Ich habe mir ein neues Hemd um- und mich in die himbeerfarbene Hose geworfen, um mir zu gefallen, während der Rest der Mannen schon in kurzen Hosen karibischen Flair vermittelt – mit all den stolzen Waden, die die Männerwelt so auszeichnen und hier tagtäglich zur Schau getragen werden.
Ich geniesse das Rauschen des Wassers, liebe den zärtlichen Wind, der mich bei dem morgendlichen Rundgang sanft streichelt, verweile an meinem einladenden Sitz und versenke mich in Wind, Wasser und Wellen – irgendwann wird schon ein Delfin auftauchen oder gar ein Wal: Warten und Weilen ist angesagt. Heimlich rezitiere ich „Stufen“ von Hermann Hesse – eine Lebensbilanz.
Die spanischen Lektionen der ersten beiden CDs sind erfolgreich absolviert, den Rest von drei CDs vernasche ich auch noch. Das politische Denken hat am Sonntag Pause, stattdessen widme ich mich der italienischen Renaissance, einer Zeit, die mir immer als denkbare Alternative einer Lebenszeit erschien: Florenz, Pisa, Verona, Venedig, Siena, Rom – all‘ die Fürstenstädte, dazu noch Romeo und Julia, Michelangelo, die Medici und Botticelli. Und ich laufe immer noch mit dem Degen `rum, um einen Montague zu fordern. Gift ist an der Tagesordnung, um sich seiner Feinde und Freunde zu entledigen – es sei denn, man hat den Papst auf seiner Seite…
Leonhard Cohen reisst mich mit „Halleluja“ aus den Träumen und schenkt mir gleichzeitig Schlaf.
09.03.20 C a r i b i k… welch eine Enttäuschung um 0900, als wir in der Passage weder auf Back-, noch auf Steuerbord irgendein Stück Land in den tief liegenden Wolken erkennen können. Allein die Sturmvögel/Gannets deuten an, dass Land in der Nähe ist, wo sie ihre Küken mit Fisch versorgen. Und als es dann bei raumem Wind mit 6 – 7 Bf auch noch eine kräftige Schauer gibt, ist der Traum zum „Fluch der Karibik“ – allerdings ohne Captain Sparrow – geworden.
Irgendwie will der Tag nicht gelingen – die Renaissanceideen von gestern sind von gestern; so ein Morden und Gemetzel wie in der Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts in Florenz, Siena und Venedig herrscht, wird durch keine Schöngeistigkeit ersetzt, zumal die heilige Inquisition auf ihre Weise auch noch ihre Opfer sucht. Und Savonarola als Warner gegen die verlodderte Bourgeoisie wettert.
Und Immanuel Kant drängt sich gerade jetzt auf, wo ich keine Lust auf „Kritik an der reinen Vernunft“ habe; da mag sein Oevre noch so viele Facetten haben – ich verstehe es immer noch nicht. Und das labrige Abendessen ist auch noch kalt – heute ist einfach nicht mein Tag, basta!
10.03.20 2130 lt Cartagena… Zentimeterweise wuchten die beiden Schlepper „Jean Gabriel“ steuerbords an den Kai – endlich wieder Land: wir sind doch alle Landratten und lieben es, festen Boden unter den Füssen zu wissen. 10 Tage Wind, Wasser und Wellen; 10 Tage Selbstdisziplin in einer anspruchsvollen Gruppe, die sich abseits des Bordgeschehens eingerichtet hat, nachdem in der Crew niemand von ihr so recht Notiz nimmt: Christliche Seefahrt geht auch anders.
Harald hat sich im Morgenlicht auf seinen Bordbalkon zurück- und ausgezogen, um die ersten warmen Sonnenstrahlen auf seinen in Norwegen gebleichten Körper zu lenken; mit den Wellen lassen wir Ludwig Wittgenstein passieren und vergewissern uns, dass wir dem Chaos der Sprache zu entrinnen trachten. Angetan von diesem Ausflug finde ich meinen Platz – im Bugkorb, sitze im Schneidersitz und träume vor mich hin, baue Luftschlösser und lasse meine Vorfahren über den Wolken passieren. Der immer gleiche Klang der anschlagenden Wasser, der milde Wind, der sich von achtern anschleicht, das stete Heben und Senken des Bugs geben der Meditation weiten Raum.
Das Meer – ein Sehnsuchtsort ? Die blauen Wasser sind eine Einladung – ein letzter Flug wie Leonardo di Caprio und Kate Winslet in der unvergesslichen Szene auf der „Titanic“ ? „Immerzu, Immerzu“ aus Büchner‘s Woyzeck geht mir durch den Sinn. Die Wiederholung, als schöpferischen Akt, wie ich sie in den buddhistischen Skulpturen und Bildnissen in Asien erlebe. Sehnsucht – ein Inbegriff menschlichen Denkens und Handelns: aktiv in der Neugierde, eher passiv in der Aufmerksamkeit: „Sucht“ und „Gier“ einmal als Botschafter positiven Denkens. Dies ist der Moment, dies ist das Moment, das ich auf dieser Reise gesucht habe – allein und doch geborgen.
Harald und Ian reissen mich aus meinen Träumen, die nun wohl schon eine Stunde währen. Fotos werden vergeben, Worte werden getauscht – kein Vergleich mit der ungeteilten Gedankenwelt, der ich nun unter dem Eindruck der 27 °C feucht-tropischer Wärme enteile, um mich nach dem Winter vor zehn Tagen nun sommerlich in kurzer Hose und T-Shirt einzukleiden und ein neues Kapitel politischen Denkens aufzuschlagen – Friedrich Wilhelm Hegel, ein Zeitgenosse der Klassiker Goethe und Schiller, gleichzeitig aber mit Fichte und Schelling der Vertreter des „deutschen Idealismus“, die sich kritisch mit der Vernunftwelt des Weltenbürgers Kant auseinandersetzen.
Es ist – auf einen einfachen Nenner gebracht – das immer gleiche Mantra: Kopf oder Bauch, Geist oder Gefühl, Ratio oder Emotio, eine Diskussion, die mein junges Leben schon in den Nächten mit Paul Memmesheimer beherrschte. Ich möchte es auf die Welt übertragen: Die Kultur der Griechen gegen die Ordnung der Römer, die Gnadenwelt des Augustinus gegen die Verstandeswelt des Scholastikers Albertus Magnus, gefolgt von der Mystik eines Thomas von Aquin, das bauchige Papsttum gegen die kopflastige Reformation der Luther, Calvin und Zwingli: Anglikanische Schwindsucht bei John Knox gegen die barocke Frömmigkeit einer Maria Stuart, ein armselig schwülstiger Ludwig XVI. gegen die Härte des Revolutionärs Robespierre: Die Welt kennt nur diesen einen Forderungskatalog: Recht oder Moral? …und der Sieger bedient immer die Guillotine!
So auch bei Hegel: Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Katholik, Jude, Muslim, Deutscher, Italiener oder Araber ist. Es gilt sich zu vergewissern: Du bist nicht der Unfall einer Liebesnacht, nicht ein Zufall der Geschichte, sondern ein einzigartiger Einfall der Schöpfung und damit ein Teil der grossen Menschheitsfamilie – „bei sich sein“ ist deshalb jenes Stichwort, mit dem sich Hegel von Kant absetzt und nach der Entzweiung wieder die Versöhnung der Gesellschaft mit einer brüchigen Theorie der „bürgerlichen Gesellschaft“ sucht, weil er im Zustimmungsprinzip des „Gesellschaftsvertrages“ vermutet, dass der Staat der Willkür des Einzelnen unterworfen werde.
Sein rechts- und staatstheoretisches Leitprinzip ist der freie Wille, der mit Recht, Moral und Sittlichkeit seine Freiheit als Mensch und Teil einer Gemeinschaft gewinnt. „Versöhnen statt Spalten“ – Johannes Rau fände seinen Slogan im Idealismus Hegels ideal verkörpert.
„Panama“ ist Sehnsuchtsort seiner Reise, sagt Harald: die Technik der Schleusen, die Schleusung durch Lokomotiven, die Gezeiten im Spiel der beiden Meere. Auch Ian hat sich Südamerika für den Rest seines Lebens als Zielort auserkoren, weil – so bildlich – die Briten dort anderen Mächten die Zerstörung und Verstörung der Kulturen überlassen hätten. Wir geniessen karibische Meereswelten beim Mittagskaffee aussenbords auf Deck F und planen schon für morgen: Wetter- und zeitbedingt ist Wolfgang als „Millionär“ wild entschlossen, seine kolumbianischen Pesos unters Volk zu bringen – Kurswert: 1 € = 4.000 Pcol, auch wenn die Stadt 40 Taximinuten entfernt liegt.
In der Abgeschiedenheit eines Laufbands, in der Eintönigkeit eines Trockenrads, in der Trockenheit einer 45 °C Sauna verliert sich der Nachmittag. Der Abend widmet sich ab 1930 der Brücke, auf der die Lichter der Stadt bereits erkennbar sind, aber weit und breit kein Pilot zu sehen – zwei Schiffe warten bereits in der Einfahrt, die in Amerika – Nord wie Süd – die Hafenbefeuerung wechselt: Steuerbord ist rot, Backbord ist grün bei der Einfahrt. Auf „Dead Slow“ läuft die Maschine, es bleibt erwartungsvoll auf der Brücke, Kapitän Sisima hat sich ein Uniformhemd übergestreift, ein Rudergänger steht bereit, das Pilotboot kündigt sich steuerbords an – und mit einem kräftigen Bass bringt sich der Lotse mit „Good evening“ in den Kreis ein, beantwortet jede Bestätigung des Rudergängers mit einem ungewohnt freundlichen „Thank you“, während sich das Schiff seinem Landeplatz nähert, ehe das Kommando „Stop engine“ den beiden Schleppern im Konzert das Lotsen überträgt: Wir sind in Südamerika angekommen – ein Kontinent wartet auf Entdeckung.